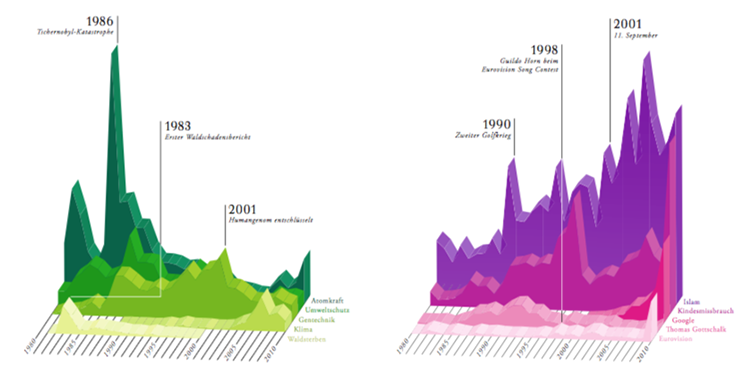Gefühlte Zukunft
Die Zeit
Prognose: Auch 2011 wird es keinen Beweis für Psi geben.
Wird unser Verhalten durch Ereignisse beeinflusst, die in der Zukunft liegen? Zumindest wird die wissenschaftliche Diskussion manchmal durch Artikel angeregt, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Psychologen diskutieren derzeit eine Arbeit von Daryl Bem von der amerikanischen Cornell University, die in der Fachzeitschrift Journal of Personality and Social Psychology erscheinen soll. Ihr Titel: Feeling the Future , zu Deutsch: „Die Zukunft fühlen“.

Heute ist nicht alle Tage
Die Zeit
Fast jeden Tag erinnert uns irgendeine Organisation an ihr Anliegen – hier ist Ihr Gedenktagkalender für 2011!
Die Infografik als PDF
Im virtuellen Lesesaal
Die Zeit
Noch ein Jahr, dann soll die Deutsche Digitale Bibliothek starten. Ein überzeugendes Konzept, wie sie funktionieren soll, fehlt noch.
Da gibt es diesen Traum: dass man in allen Büchern, die je in deutscher Sprache erschienen sind, nach Begriffen suchen kann, so einfach wie mit Google im Netz. Man gibt ein Wort in ein Suchfeld ein, lässt sich die besten Treffer dazu anzeigen und kann dann postwendend in dem jeweiligen Buch auf jener Seite lesen, auf der die gesuchten Begriffe vorkommen.

Pixel-Tristesse in Blurmany
Die Zeit
Nach dem Start von Google Street View fragen sich viele, wie sie ihr Haus wieder sichtbar machen können.
Die Deutschen sind weltweit am empfindlichsten, wenn es um ihre Privatsphäre geht – aber sie sind auch am neugierigsten, wenn sie dem Nachbarn in den Garten schauen können. Am vergangenen Donnerstag, als Google Street View online ging , stieg der Datenverkehr der Website auf das Vierfache. In keinem anderen Land der Welt gab es bei der Einführung des Fotodienstes einen derartigen Ansturm, teilte Google mit.
Und so sind manche Straßenzüge in deutschen Großstädten nun mit einem tristen Schleier überzogen. Auch der Autor dieses Artikels steuerte, wie wohl fast jeder User, zunächst einmal das eigene Heim an – es war nur ein milchiger Fleck (siehe Foto). Wer hatte bei Google sein Veto eingelegt? Das Pärchen aus dem Erdgeschoss oder die Familie im Souterrain? Oder war es die Hausbesitzerin, die in einer fernen Stadt wohnt? …

In den Topf geguckt
Die Zeit
Der Physiker und Unternehmer Nathan Myhrvold hat ein Kochbuch geschrieben und beschreibt darin die Wissenschaft, die hinter den verschiedenen Garmethoden steckt. Die spektakulären Fotos sind echt – es musste nur manchmal die Plexiglasscheibe wegretuschiert werden, die das Gargut am Auslaufen hinderte.
Ist der neue Ausweis sicher?
Die Zeit
Der elektronische Personalausweis macht das Leben bequemer – um den Preis neuer Gefahren? Ein Pro und Contra von Christoph Drösser und Susanne Gaschke
Vom 1. November an geben die Meldeämter den neuen Ausweis im Kreditkartenformat aus. Wer 24 Jahre alt oder älter ist, bezahlt eine Gebühr von 28,80 Euro, Erwachsene unter 24 Jahren müssen sechs Euro weniger ausgeben – dafür bleibt ihr Ausweis auch nur sechs Jahre gültig, der Ausweis der älteren hingegen zehn.
Zwei zusätzliche Möglichkeiten des Ausweises können nur genutzt werden, wenn der Nutzer sich dafür entscheidet: die Online-Signatur und die sogenannte elektronische Identitäts-Funktion. Erstere soll online rechtsgültige Unterschriften im Verkehr mit Behörden ermöglichen, Letztere Internetgeschäfte sicherer machen. Das gesamte Konstrukt ist umstritten, auch in der Redaktion. Christoph Drösser hält es für sicher, Susanne Gaschke nicht.

Die Giga-Brummis der Zukunft
Die Zeit
Spediteure wollen gigantische Laster auf die Straße bringen. Die Eurocombis sollen Umwelt und Asphalt schonen. Kritiker befürchten zu viel Verkehr auf den Autobahnen.
Die Infografik als PDF
Der Meister der unerhörten Formen
Die Zeit
Ihn kannten wenige, sein Apfelmännchen machte Karriere: Benoît Mandelbrot schenkte der Mathematik eine neue Ästhetik – seine Spuren bleiben unauslöschlich.
„Bodenlose Wunder entspringen aus einfachen Regeln, die ohne Ende wiederholt werden.“ Das waren die letzten Worte, die Benoît Mandelbrot bei seinem letzten öffentlichen Vortrag sprach. Das war im Februar 2010 auf einer Konferenz in Kalifornien.
„Entschuldigen Sie, dass ich im Sitzen rede – ich bin sehr alt“, hatte er am Anfang seines Vortrags gescherzt.
Sein Körper war wohl schon vom Bauchspeicheldrüsenkrebs geschwächt, am vergangenen Donnerstag ist der 85-Jährige daran gestorben …
Flimmernetz
Die Zeit
Nach dem Start von Google Street View fragen sich viele, wie sie ihr Haus wieder sichtbar machen können.
Am Mittwoch vergangener Woche startete auf dem Digitalkanal ZDF neo die amerikanische Kultserie Mad Men . Die deutschen Fernsehzuschauer bekamen einen Einblick in die Geschäfte, Affären und Intrigen einer New Yorker Werbeagentur im Jahr 1960. Jedenfalls jene Zuschauer, die aufs deutsche Fernsehen angewiesen sind. Die eingefleischten Mad Men- Fans befinden sich dagegen längst im Jahr 1965, in dem die aktuelle vierte Staffel der Serie spielt. Auch deutsche Aficionados sind schon fünf Jahre weiter als der gemeine ZDF-Konsument.
Ebenfalls in der vergangenen Woche kündigten zwei Hersteller Geräte für das neue Google TV an, das es vorerst nur in den USA geben wird …