Autor: cd

Besondere Zahlen
Die Zeit
Jeder weiß, was gerade und ungerade Zahlen sind. Auch von Primzahlen haben die meisten schon gehört. Mathematiker kennen aber viele weitere Klassen besonderer Zahlen, denen sie manchmal originelle Namen geben.

Die Freiheit der verhüllten Frau
Zeit Online
Sind Miniröcke wirklich fortschrittlich? Eine Ausstellung muslimischer Mode hinterfragt das westliche Modediktat: Auch die Bedeckung des Körpers kann befreiend wirken.
Wenn sie ihre Kinder zum Fußballtraining fährt, zieht sie Jeans, T-Shirt und Jogginghosen an – die Alltagskleidung echter Soccer Moms. Aber Saba Ali, eine an der San Francisco Bay lebende pakistanischstämmige Amerikanerin, trägt dazu den Hidschab. Und betont, dass sie sich gegen den Willen ihres Vaters dazu entschlossen hat. „Das ist das Gegenteil der allgemeinen Vorstellung, dass der Vater, Bruder oder Ehemann der Frau vorschreibt, sich zu verhüllen“, sagt sie. „Es ist meine eigene Entscheidung gewesen, und bei allen meinen Freundinnen und Bekannten war es genauso.“
Saba Ali kennt viele Arten, das Kopftuch zu binden – und hat den Hidschab deswegen nun auch an Kleiderpuppen in einer Ausstellung des de Young Museum in San Francisco drapiert. Contemporary Muslim Fashions setzt die Mode in den Plural. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass man mehr als eine Milliarde islamischer Frauen, die sich gemäß ihrer Religion und Kultur kleiden wollen, nicht über einen Kamm scheren darf. Und dass die islamischen Kleidungsregeln ziemlich vielfältig ausgelegt werden und nicht einfach nur die Körper der Frauen mit Schleiern, Kopftüchern und langen Gewändern möglichst unsichtbar machen wollen …
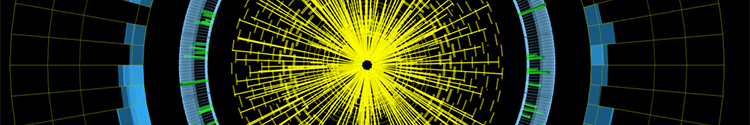
Wetten, die Welt geht unter?
Die Zeit
Als der Teilchenbeschleuniger LHC an den Start ging, begann ein kurioses Gewinnspiel: 500 Dollar auf die Apokalypse! Jetzt ist Zahltag.
Panische Aufrufe im Internet, Todesdrohungen gegen beteiligte Forscher und mehrere Versuche, ein Experiment per Klage vor Gericht zu stoppen: Als vor zehn Jahren am europäischenKernforschungszentrum Cern der Large Hadron Collider (LHC) in Betrieb genommen wurde, war die Aufregung gewaltig. Einige Zeitgenossen fürchteten, der riesige Teilchenbeschleuniger könne die Welt zerstören. Denn ein Tübinger Wissenschaftler hatte behauptet, in den hochenergetischen Kollisionen der Elementarpartikeln könnte möglicherweise ein winziges Schwarzes Loch entstehen, welches immer weiter anwachsen und am Ende die Erde verschlucken werde. Als dann am 10. September 2008, einem Mittwoch, die ersten Protonen durch den Ringbeschleuniger geschickt wurden, rechneten die Warner mit dem Schlimmsten.
Während in Europa die Diskussion zwischen Apokalypse und Amüsement pendelte, ging bei der Long Now Foundation in San Francisco eine sportliche Wette ein. Ein gewisser Joe Keane wettete 500 Dollar darauf, dass der LHC binnen zehn Jahren die Erde zerstören werde – und schuf damit das Paradebeispiel einer Lose-lose-Situation: Entweder wäre das Geld weg oder gleich der ganze Planet. So oder so, Keane konnte nur verlieren.

Fahndung im Stammbaum
Die Zeit
Mit Genetik und Ahnenforschung klären Ermittler in den USA Gewalttaten auf, die Jahrzehnte zurückliegen.
Paul Holes saß in seinem geparkten Auto in Citrus Heights, einem Vorort der kalifornischen Hauptstadt Sacramento, und beobachtete ein Haus auf der anderen Straßenseite. Es war der 29. März dieses Jahres, und der Ermittler der Staatsanwaltschaft von Costa County stand vor der vielleicht schwersten Entscheidung seiner Laufbahn. Sollte er hinübergehen, klingeln und Joe DeAngelo ins Gesicht sagen, dass er ihn für den seit Jahrzehnten gesuchten Golden-State-Killer hielt? Es wäre die Krönung seiner Karriere gewesen, an seinem letzten Arbeitstag – am nächsten Tag stand seine Frühpensionierung mit 50 Jahren an.

Fields-Medaille für Peter Scholze
Der 30-jährige Bonner Mathematiker Peter Scholze hat heute die Fields-Medaille erhalten. Das habe ich gleich für mehrere Medien aufgeschrieben und -genommen:
Unterwegs in perfektoiden Räumen (Die Zeit)
Gold für Mathegenie Peter Scholze (Zeit Online)
Unterwegs in perfektoiden Räumen
Der Bonner Mathematik-Star Peter Scholze erhält die begehrte Fields-Medaille. Kann man begreifen, wofür?
Nein, Sie werden am Ende dieses Artikels nicht verstehen, was die „perfektoiden Räume“ sind, für die Peter Scholze beim Internationalen Mathematikerkongress in Rio de Janeiro die Fields-Medaille bekommen hat. Schon allein deshalb, weil der Autor dieses Artikels (der ein Mathematik-Diplom an derselben Universität erworben hat wie der Preisträger) sie nicht versteht und ebenso wenig die meisten Mathematik-Professoren. Selbst Scholzes Doktorvater gibt zu, nicht wirklich mit dessen Methoden vertraut zu sein. – Herr Scholze, sind es zehn, hundert oder tausend Mathematiker, die mit Ihnen auf Augenhöhe diskutieren können? „Eher zehn.“ Die Luft muss dünn sein da oben.
Trotzdem war sich die Fachwelt selten so einig, dass ein Mathematiker diese Auszeichnung verdient hat. Die Fields-Medaille wird alle vier Jahre an ein paar Forscher unter 40 vergeben, die meisten bekommen sie bei der letzten möglichen Gelegenheit. Scholze ist 30, und viele meinen, der Preis hätte ihm schon vor vier Jahren zugestanden.
Es war also keine Überraschung für ihn, als er vor ein paar Monaten eine E-Mail vom Präsidenten der Internationalen Mathematischen Union bekam. Der fragte, ob man sich mal per Skype unterhalten könne. „Ich konnte mir schon denken, worum es ging“, sagt Scholze heute. „Aber gerade weil mir das immer von allen Seiten gesagt worden war, war es dann doch eine große Freude und auch eine Erleichterung, dass ich den Preis kriege.“ Nur den engsten Vertrauten durfte er davon erzählen, auch die Presse musste bis zum Mittwochnachmittag dieser Woche Stillschweigen bewahren.
Wenn man Scholze im Interview bittet, seine Ideen möglichst allgemein verständlich zu erklären, dann beginnt er mit den ganzen Zahlen, 1, 2, 3, 4 …, aber schon nach drei Sätzen schaut er sein Gegenüber nicht mehr an, erklärt, dass die ganzen Zahlen Funktionen in einem dreidimensionalen Raum seien und die Primzahlen den Knoten in diesem Raum entsprächen. „Aber man darf diese Aussage auf keinen Fall zu wörtlich nehmen.“ Er merkt, dass er sein Publikum verliert, und er reagiert darauf nicht mit Arroganz, sondern eher mit Resignation. Wie soll er die Dinge, über die er seit Jahren mit unvorstellbarer Intensität nachdenkt, in ein paar Minuten zusammenfassen? „Mathematik zeichnet sich dadurch aus, dass sie extrem kumulativ ist“, sagt Scholze. Ein Stein baut auf dem anderen auf, und man kann beim Erklären nicht mit der Spitze des Gebäudes beginnen.
Die Disziplin, in der Scholze arbeitet, nennt sich Arithmetische Geometrie. Sie baut Brücken zwischen der Zahlentheorie, also den erwähnten ganzen Zahlen, und geometrischen Objekten, von denen man sich eine bildhafte Vorstellung machen kann. Scholzes Faszination dafür begann, als der 16-jährige Gymnasiast vom Beweis des Großen Fermatschen Satzes hörte, den der Brite Andrew Wiles 1994 geliefert hatte, 350 Jahre nach der Formulierung durch Pierre de Fermat. Der Satz besagt, dass die Gleichung x n + y n = z n nicht von ganzen Zahlen für x, y und z erfüllt werden kann, wenn n größer als 2 ist. Als Schüler konnte Scholze die Details noch nicht verstehen. Aber das Thema packte ihn, er wollte mehr erfahren.
Peter Scholze wurde 1987 in Dresden geboren, zwei Jahre vor dem Mauerfall. Seine Mutter war Informatikerin, sein Vater Physiker. Sie schickten ihn auf das Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshain, das schon zu DDR-Zeiten auf Mathematik spezialisiert war. Diese Entscheidung sollte sich als schicksalhaft erweisen: Als sein Mathelehrer ihm nichts mehr beibringen konnte, schickte er Scholze zum ehemaligen Hertz-Gymnasiasten Klaus Altmann, mittlerweile Professor für Mathematik an der Freien Universität Berlin. Der reichte ihn an seinen ehemaligen Betreuer Michael Rapoport weiter, ebenfalls ein Absolvent des Gymnasiums, der an der Universität Bonn lehrte.
Scholze fühlt sich als Entdecker, nicht Schöpfer neuer Konzepte
Diese Seilschaft war segensreich, brachte sie doch den jungen, noch unsicheren Scholze auf eine beispiellose akademische Überholspur. Rapoport erkannte Scholzes Talent, die Universität erließ dem 18-Jährigen einen großen Teil der Pflichtveranstaltungen. So machte er nach drei Semestern seinen Bachelorabschluss, nach zwei weiteren den Master. Promoviert wurde er mit 24, und noch vor seinem 25. Geburtstag berief ihn die Universität zu Deutschlands jüngstem ordentlichen Professor.
Zu dieser Zeit war Scholze schon international bekannt durch seine Beiträge zum sogenannten Langlands-Projekt – dem Paradebeispiel für den Versuch, auf sehr hoher theoretischer Ebene scheinbar weit entfernte Gebiete der Mathematik zusammenzubringen, um dadurch höhere Erkenntnisse zu gewinnen. Die großen ungelösten Probleme, darin sind sich die meisten Mathematiker einig, lassen sich nur durch solche Brückenschläge bezwingen.
Was ich jetzt mache, ist eingebettet in eine größere Struktur, die ich noch nicht verstehe
Peter Scholze, Mathematiker und Fields-Preisträger
Natürlich ist die Zahl derjenigen, die gleich in mehreren mathematischen Disziplinen auf einem solchen Niveau arbeiten können, klein. Und noch seltener sind die Meister, die durch neue Begriffsbildungen das Feld voranbringen. Genau das hat Scholze mit seinen perfektoiden Räumen getan, die wenig mit der Laienvorstellung vom Raum zu tun haben, sondern statt auf den reellen auf den exotischen sogenannten p-adischen Zahlen basieren. Das bescheinigt ihm Michael Harris von der Columbia-Universität, der selbst wichtige Beiträge zum Langlands-Programm geleistet hat: „In der zeitgenössischen Mathematik gibt es selten ein so klares Beispiel für eine neue Begriffsbildung. Der perfektoide Raum ist eines der schwierigsten Konzepte, die je in die arithmetische Geometrie eingeführt wurden – und die hat eine lange Tradition schwieriger Begriffe.“
Eine mathematische Revolution zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Kollegen die Arbeit erleichtert. So wie Alexander der Große den Gordischen Knoten durchschlug, bringt eine solche Idee Ordnung und eine neue Einfachheit in ein mathematisches Gebiet. Scholze sagt: „Einige der aktuellen Arbeiten wären gar nicht möglich ohne die neuen Begriffsbildungen, weil das alles viel zu kompliziert würde.“
Fühlt sich der junge Mathematiker als Schöpfer dieser neuen Konzepte? Nein, er entdecke sie, sagt er. „Ich fühle mich ein bisschen wie ein Physiker, der versucht, die Natur, die um ihn herum ist, zu verstehen.“ Selbst ein Mathematiker auf einem anderen Stern würde also dieselben Begriffe finden wie er? Mit der Antwort auf diese Frage lässt sich Peter Scholze gestoppte 26 Sekunden Zeit, bevor er sagt: „Ja und nein. Was ich jetzt mache, ist eingebettet in eine größere Struktur, die ich noch nicht verstehe. Aber ich bin der Meinung, dass viele dieser Begriffsbildungen unausweichlich sind. Ich habe nicht die Wahl, sondern ich muss diese Definition hinschreiben.“
Peter Scholze ist ein introvertierter Mensch, und der Medienrummel ist ihm zuwider. Auf eine Interviewanfrage der ZEIT antwortete er schon vor einigen Monaten, dass er dazu „generell wenig Lust“ verspüre. Später erklärte er sich zu einem Skype-Interview bereit. Die Universität Bonn hat ihm nun einen Kollegen als Medienbetreuer zur Seite gestellt, der die Presseanfragen in geordnete Bahnen lenken soll. Vor drei Jahren machte Scholze Schlagzeilen, weil er den mit 100.000 US-Dollar dotierten „New Horizons“-Preis für Mathematik ablehnte, der zur Reihe der Breakthrough-Preise gehört. Ins Leben gerufen wurden sie von Silicon-Valley-Größen wie Sergey Brin (Google) und Mark Zuckerberg (Facebook), die Preisträger werden in einer Oscar-reifen Zeremonie geehrt – auf eine solche Show hatte Scholze wohl keine Lust.
Scholzes Oberseminar ist Pilgerstätte für Nachwuchsmathematiker
Aber es wäre falsch, ihn in eine Reihe mit dem Mathematik-Eremiten Grigori Perelman (ZEIT Nr. 35/06) zu stellen, der sich komplett aus der Forschergemeinde zurückgezogen hat. Im Gegenteil: Wer mit Scholze gearbeitet hat, beschreibt ihn als einen zugänglichen, unkomplizierten und hilfsbereiten Kollegen. „Er ist extrem großzügig“, sagt etwa Matthew Morrow vom französischen Forschungszentrum CNRS in Paris, der bei Scholze als Postdoc gearbeitet hat. „Er ist ein Mentor für jüngere Mathematiker – auch wenn sie, wie ich, älter sind als er.“ Eugen Hellmann, der mit Scholze zusammen promoviert hat, bestätigt das: „Es war immer sehr einfach, mit ihm zu diskutieren. Er hat einem nie das Gefühl gegeben, dass er auf einer anderen Stufe steht.“ Sein Doktorvater Michael Rapoport findet eine weitere Eigenschaft Scholzes bemerkenswert: „Er ist weitgehend konfliktfrei. Er streitet sich nicht, beharrt nicht auf irgendwelchen Sachen – obgleich er auch in der Mathematik seine Prinzipien hat, von denen er nicht abgehen wird.“
Peter Scholze ist erst der zweite Deutsche, der die Fields-Medaille bekommt, nach Gerd Faltings, der den Preis 1986 erhielt. Und er ist der einzige deutsche Medaillenträger, der tatsächlich in Deutschland arbeitet. Darauf ist Karl-Theodor Sturm stolz, der das Hausdorff-Zentrum für Mathematik in Bonn leitet, einen im Rahmen der Exzellenzinitiative gegründeten Forschungsverbund. Nur mit einer solchen Einrichtung sei es möglich gewesen, den Jungstar zu halten, trotz Angeboten aus Harvard, Princeton und vom MIT.
Scholzes Oberseminar in Bonn ist zu einer Pilgerstätte für Nachwuchsmathematiker aus aller Welt geworden. „Da werden seine Arbeiten ausgetestet“, sagt Michael Rapoport, oft werde über sehr frische Skripte diskutiert. „Das muss man sich vorstellen wie bei Mozart, der die Ouvertüre von Don Giovanni noch am Nachmittag des Aufführungsabends fertiggestellt hat.“ (Diese Entstehungsgeschichte der Oper ist umstritten.)
Die Fields-Medaille wird gern als der „Nobelpreis der Mathematik“ bezeichnet. Aber dem widerspricht Peter Scholze vehement. Die Auszeichnung bekomme man ja nicht für sein Lebenswerk, dafür gebe es den – auch besser dotierten – Abelpreis. Er sieht die Auszeichnung eher als einen Etappensieg. „Mit der mathematischen Forschung habe ich doch gerade erst angefangen.“

Raus mit der Meinung!
NZZ Folio
Trump-Wahl, Brexit, Minarett-Initiative: Spektakuläre Fehlprognosen haben den Ruf der Meinungsforschung beschädigt.
Eine repräsentative Meinungsumfrage in den USA fand im März heraus: Nur 37 Prozent der Amerikaner vertrauen Meinungsumfragen, 60 Prozent trauen ihnen nur wenig oder gar nicht.
Konsequenterweise müsste nun eine Mehrheit auch diese Zahlen anzweifeln. Doch es ist kein Wunder, dass die Demoskopen im Moment etwa ein so hohes Ansehen geniessen wie Wahrsagerinnen. Zu oft lagen die Meinungsforscher in den letzten Jahren eklatant daneben: Sie sahen weder den Sieg der Konservativen bei den vorletzten Parlamentswahlen in Grossbritannien voraus noch das Votum für den Brexit; in der Schweiz prognostizierten sie fälschlicherweise eine Ablehnung der Minarett-Initiative; in Deutschland unterschätzten sie lange Zeit die Rechtspartei AfD. Die spektakulärste Fehlprognose lieferten sie bei den US-Wahlen im November 2016. Noch am Wahlmorgen gab die «New York Times» Hillary Clinton eine 85prozentige Siegeschance. Als die Ergebnisse dann eintrudelten, konnten die Nutzer im Netz sehen, wie die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Clinton innerhalb weniger Stunden auf null sank.
Aber die Häme, mit der die Meinungsforscher darauf überschüttet wurden, ist ungerecht …

„Gereizt, zynisch und paranoid“
Die Zeit
Der Internetexperte Jaron Lanier fordert in seinem neuen Buch: Löscht eure Facebook- und Twitter-Accounts! Ein Gespräch über die subtile Beeinflussung der sozialen Medien und die massive Zunahme negativer Emotionen.
DIE ZEIT: Herr Lanier, Ihr neues Buch trägt die Botschaft schon im Titel: Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst. Dabei haben Sie doch selbst gar keine Social-Media-Accounts, weder auf Facebook noch auf Twitter. Wie können Sie da anderen Ratschläge geben?
Das Interview mit Jaron Lanier habe ich mehrmals verwertet, auch im Radio. Hier gibt es weitere interessante Ausschnitte daraus:
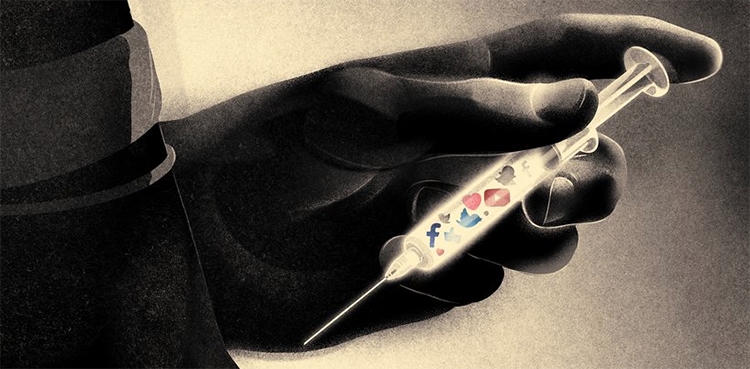
Eine Überdosis Facebook
Die Zeit
Sie haben bei Google oder Twitter gearbeitet – dann entdeckten sie die schädliche Seite der sozialen Medien. Aussteiger aus dem Silicon Valley kritisieren die Firmen jetzt als asozial, deren Angebote süchtig machten. Sie verweisen auf Alternativen.
So langweilig wie möglich versucht Tristan Harris sein Smartphone zu machen. Die Anzeige ist nicht bunt, sondern schwarz-weiß. Auf dem Start-Bildschirm sind nur die notwendigsten Apps zu sehen. Und Harris hat allen Anwendungen verboten, dass sie ihn mit piepsenden, vibrierenden Mitteilungen nerven. Nur Nachrichten von echten Menschen dürfen um seine Aufmerksamkeit buhlen, zum Beispiel eine SMS.
Jetzt will Mark uns verkuppeln
Zeit Online
Facebook wird dank einer neuen Datingfunktion zur Partnerbörse. Das ist nur konsequent und könnte ziemlich erfolgreich sein: Das soziale Netzwerk ist das Ur-Tinder.
Mark Zuckerberg hatte gestern die schwierige Aufgabe, mit seiner Rede zum Auftakt der Entwicklerkonferenz F8 in San José zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Erstens die Entwickler und Entwicklerinnen im Saal – 5.000 Menschen, die teilweise als Ein-Personen-Firmen davon leben, das Ökosystem des sozialen Netzwerks um neue Anwendungen zu bereichern, und dabei an Facebooks Datenschnittstelle wie an einer Nabelschnur hängen.
Zweitens die allgemeine Öffentlichkeit, die sich in den vergangenen Monaten vor allem über Facebooks schludrigen Umgang mit ebendiesen Daten erregt hat. Die beiden Gruppen haben durchaus widerstrebende Interessen: Einige Entwickler waren in letzter Zeit erbost darüber, dass sie nach der Affäre um Cambridge Analytica nicht mehr so umfassenden Zugriff auf die Profile der Nutzer hatten wie früher.